Zwei Artikel mit Analysen und Einschätzungen von Strategieexperte Mauro Mantovani und Alt Botschafter Martin Dahinden haben in den letzten Wochen zu kontroversen Diskussionen geführt. Diese beziehen sich auf aktuelle und zukünftige Bedrohungsszenarien und die daraus abzuleitenden Konsequenzen für die Armee. Der reflexartige Aufschrei, wenn das offizielle Bedrohungsbild hinterfragt wird, liess nicht lange auf sich warten. Anstatt sich mit den kritischen Aussagen auseinander zu setzen, wurde das Fachwissen und die Kompetenz der Autoren angezweifelt. Polemik und Scheuklappen müssen in Zeiten knapper Finanzmittel in den Hintergrund treten.
Dabei ist es eine militärische Notwendigkeit, Bedrohungen und ihre Implikationen immer wieder neu zu bewerten und daraus entsprechende Handlungsrichtlinien abzuleiten. Unterlassen wurde bisher eine ernsthafte Debatte darüber, auf welche Bedrohungen sich das Land und die Armee in erster Linie einzustellen haben. Es wird nicht genügen, vom gefährlichsten Fall, einem bewaffneten Angriff auf die Schweiz, auszugehen und zu glauben, damit sei es getan. Bis Russland im Februar 2022 erneut die Ukraine angriff, diesmal ohne dem Westen Gelegenheit zu geben, den eklatanten Bruch des Völkerrechts zu beschönigen, beherrschte Hybridität die sicherheitspolitische Debatte. Inzwischen scheint die Anwendung hybrider Methoden, zumindest in unserer nationalen Diskussion, nur noch ein Vorspiel zur offenen militärischen Aggression (auch) gegen die Schweiz zu sein. Daraus abzuleiten, dass deshalb «Verteidigung» das sicherheits- und verteidigungspolitische Denken und Handeln dominieren sollte, wäre fahrlässig. Raffinierte und perfide Desinformations- und Beeinflussungsoperationen sind nicht nur feindliche Möglichkeiten, sondern Realität, ebenso wie Sabotage strategisch wichtiger ziviler Objekte und Infrastrukturen, Mordkomplotte gegen Schlüsselpersonen der Rüstungsindustrie, Störungen des Flugverkehrs sowie intensivierte Spionage, nicht nur mit Cyber-Mitteln. All diese Aktivitäten untergraben die Stabilität unserer Gesellschaft, schwächen die Bindung zwischen Behörden und Bevölkerung und die Resilienz des Staates. Die Armee muss in der Lage sein, sich in allen Bedrohungsformen flexibel und bedarfsgerecht, möglichst im Hintergrund, einzubringen und zu operieren. Wirkung muss Vorrang haben vor Selbstdarstellung und dem Wunsch, als wichtig wahrgenommen zu werden. Das muss die Armee jetzt können, nicht erst 2030, 2035 oder 2045. Was nützt es, wenn der gefährlichste Fall geplant und budgetiert wird, die gesprochenen Mittel aber gerade für den dringendst benötigten Ersatz veralteter Systeme reichen und die rasche Modernisierung auf die lange Bank geschoben wird? Der populistische Vorwurf, die Schweiz leiste sich gerade mal eine mässig vorbereitete Armee, nur um dem Prädikat «bewaffnete Neutralität» gerecht zu werden, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Dies zeigen auch die hitzigen und kontroversen Debatten im Parlament. Müssten die geopolitischen Umwälzungen nicht zu anderen Prioritäten und Konsequenzen führen?
Die Baustellen
Die Schwierigkeiten, mit denen sich die Armee konfrontiert sieht, sind vielfältig und schwerwiegend. Stand bis vor kurzem noch das fehlende Geld im Vordergrund der Diskussion, so sind es heute zunehmend die Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Beschaffungsprojekten. Die Tatsache, dass die schlechten Nachrichten mehr Aufmerksamkeit erhalten, verzerrt die Wahrnehmung und blendet aus, dass viele Projekte grundsätzlich auf Kurs sind, auch wenn bei einigen nachgebessert werden muss. Viel zu wenig Beachtung findet der Zustand der Armeebestände und damit verbunden die Revision des Dienstpflichtsystems. Das Parlament muss erst noch beweisen, dass es den in dieser Frage seit Jahren trägen Bundesrat konstruktiv überholen will. Vielleicht wird der Abstimmungskampf über die Volksinitiative für einen Service Citoyen dieser Frage endlich die ihr gebührende Aufmerksamkeit verschaffen. Der Entscheid des Parlaments in der Wintersession 2024, dem VBS zusätzlich 530 Millionen zu sprechen, war mit der Auflage verbunden, im Gegenzug Stellen im VBS abzubauen. Die Logik dahinter liegt auf der Hand: Die Armee braucht Waffen und Ausrüstung aber weniger Personal in Bern. Eine praktische Folge dieser Logik ist zum Beispiel, dass nun in allen Bereichen des VBS linear Stellen abgebaut werden, zum Beispiel auch im Bundesamt für Cybersicherheit, das bereits heute substanziell unterdotiert ist. Die Überlegung, sich einseitig auf die Ausrüstung für den gefährlichsten, aber auch unwahrscheinlichsten Fall zu konzentrieren und den weniger spektakulären, aber heute schon realen Fall zu vernachlässigen, zeigt hier ihre verhängnisvollen Kehrseiten.
Wahlen im Bundeshaus und an der SOG-Spitze
Am 12. März findet die Ersatzwahl für die abtretende Bundesrätin Viola Amherd statt. Dies in einer Zeit, in der die sicherheits- und armeepolitischen Umwälzungen in Europa zu einer grossen Verunsicherung in der Gesellschaft geführt hat. Das VBS gewann in dieser Zeit zunehmend an Bedeutung. Die Armee musste rasch und oft gegen politische Widerstände auf Vordermann gebracht werden. Jahrzehntelang versäumte Investitionen müssen nachgeholt und die Stellung der Schweiz im internationalen Umfeld geklärt werden. Es ist der SOG ein grosses Anliegen, der Vorsteherin des VBS für ihre Erfolge und die sehr anspruchsvollen Jahre an der Spitze des Verteidigungsdepartements herzlich zu danken. Die SOG sichert dem neu gewählten Bundesrat und Chef VBS ihr volles Vertrauen und fachliche Unterstützung zu. Sie freut sich auf eine enge und kritisch-konstruktive Zusammenarbeit. Die SOG verzichtet auf ein Hearing der Bundesratskandidaten. Dies ist den politischen Parteien vorbehalten, denn nur wer wählen kann, soll zu Anhörungen einladen.
An der Delegiertenversammlung der SOG vom 8. März wird ein neuer Präsident gewählt. Die Findungskommission schlägt zwei fähige und kompetente Kandidaten aus der lateinischen Schweiz zur Wahl vor: Milizbrigadier Yves Charrière, aus Aubonne VD, amtierender Vizepräsident der SOG, und Oberst i Gst Michele Moor, aus Cureglia TI, Präsident der SOG von 2005-2008. Ich wünsche beiden Kameraden das nötige Soldatenglück.
Oberst Dominik Knill, SOG Präsident 28.08.2021 - 08.03.2025
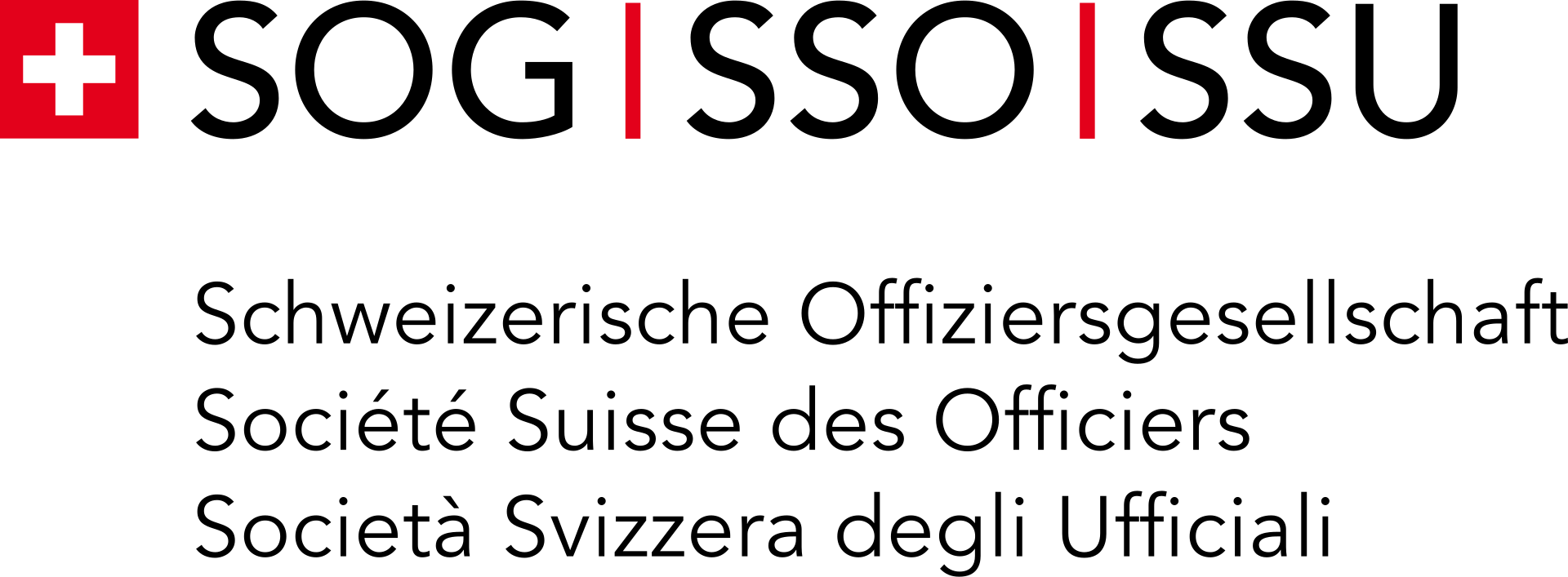
Comments and Responses
Be the First to Comment