Die junge Tochter fragt ihren Vater, ob denn alle Märchen mit: «Es war einmal…» beginnen? «Nicht alle!» antwortet der Vater. Viele beginnen auch mit: «Wenn ihr mich wählt, verspreche ich…» Im Namen der SOG gratuliere ich den wieder- und neugewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier ganz herzlich. Allen Volksvertretern, die in den vergangenen Jahren das wichtigste Sicherheitsorgan, unsere Armee, mit Wort und Tat unterstützt haben, gebührt unser Dank und unsere Anerkennung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Die Schweizer Armee untersteht dem Primat der Politik. Die Schweizerische Bundesverfassung bestimmt, dass die Bundesversammlung (das Parlament) die oberste Gewalt im Bund ist (Artikel 148). Der Bundesrat, als kollektives Exekutivorgan ist für die strategische Führung und den Einsatz der Armee zuständig. So weit, so gut. Es müsste doch im ureigensten Interesse der Politik liegen, dass ihr wichtigstes Sicherheitsinstrument für den Ernstfall bestmöglich ausgerüstet, alimentiert und ausgebildet ist. Folglich müsste die Politik die dringend benötigten finanziellen Mittel für die Armee schnellstmöglich sprechen und dafür sorgen, dass die Ressource "Bürger in Uniform" langfristig gesichert ist. In der kommenden Wintersession wird der Bundesrat dem Parlament vorlegen, wie stark das Verteidigungsbudget in den nächsten Jahren wachsen soll. Die parlamentarische Vorgabe von 1% des BIP bis 2030 will der Bundesrat jedoch erst 2035 erfüllen. Nun scheint auch im Bundesrat angekommen zu sein, was früher bei Armeebeschaffungen leider die Regel war, wenn das Geld fehlte. «Schieben, strecken, streichen». Letzteres wäre ein Armutszeugnis der Politik sowie eine grosse Bürde für die Armee.
"Nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten sollt ihr sie erkennen." Die Schweizerische Offiziersgesellschaft erwartet vom Bundesrat und Parlament, dass es seine Verantwortung für eine starke, glaubwürdige und moderne Milizarmee wahrnimmt.
Unter-, Über- und fehlende Bestände
In der Militärgeschichte spielte die Alimentierung von Soldaten eine wesentliche Rolle. Die Fähigkeit einer Nation oder eines militärischen Führers, die Truppen effektiv zu alimentieren, war oft entscheidend für den Erfolg von Feldzügen. War die Alimentierung ungenügend, kam es zu Problemen mit niedriger Moral, Desertionen und Meutereien. Bei einem Effektivbestand von 147'000 hat die Armee einen Überbestand von rund 7'000 Soldaten. Mit einer Verordnung sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, damit zwei Jahrgänge noch länger eingeteilt bleiben. Damit machen wir uns etwas vor und beruhigen in erster Linie jene Gemüter, die in einer vorzeitigen Entlassung einen Abbau des Effektivbestandes auf knapp 130'000 Angehörige der Armee (AdA) sehen. Wohlverstanden, diese Angehörigen der Armee haben die Ausbildungspflicht erfüllt und warten auf das Ende ihrer Dienstpflicht. Sie könnten für Assistenzdienste in Notlagen aufgeboten werden. Als Überzählige füllen sie die Bestände der Formationen auf. Gegen Ende des Jahrzehnts läuft die Armee in einen Unterbestand. Warum also nicht Farbe bekennen und die Misere aufzeigen, in der wir uns mit dem aktuellen Dienstpflichtmodell befinden? Das Argument, die Überzähligen seien ja ausgerüstet und schneller einsatzbereit geht an der Realität vorbei. Ehrlicher wäre es zuzugeben, dass wir schon heute für 130'000 keine vollständige Ausrüstung haben. Wenn der Bundesrat Ende 2024 ein neues Dienstpflichtmodell vorschlägt, muss die Armee realistisch und unmissverständlich aufzeigen, wie es mit der Unteralimentierung weitergeht. Mittelfristig ist der Sollbestand von 100'000 auf 120'000 zu erhöhen (ergibt einen Effektivbestand von gut 165'000), die Diensttage von 245 um 20% zu erhöhen, die Anzahl WK von 6 auf 8 zu erhöhen und die Verweildauer in der Armee auf mindestens 10 Jahre zu erhöhen. Die Rekrutenschule soll bis zum dreissigsten Altersjahr absolviert werden können. Warum soll ein militärdiensttauglicher Bürger nicht zweimal zur Rekrutierung aufgeboten werden können? Ein Wiedereintritt in die Armee muss bei Bedarf unbürokratisch möglich sein. Die Wiedereinsetzung von «Landwehr»-Formationen ist bei der Alimentierung zu berücksichtigen. Den Durchdieneranteil auf 15% zu begrenzen, entspricht einer politischen Vorgabe. Rechtlich zu klären ist die Ausweitung der Funktionen und den Bestandsaufbau. Für die internationale Zusammenarbeit und gemeinsame Übungen im Ausland gewinnt das Durchdienermodell zunehmend an Bedeutung und muss angepasst werden.
Die Pflicht zu dienen
Die SOG setzt sich für eine umfassende Sicherheitsdienstpflicht ein. Diese sieht vor, dass jeder Schweizer militärdienstpflichtig ist, sich Schweizerinnen freiwillig melden, die überbordende Abwanderung in den Zivildienst endlich gestoppt wird und dieser mit dem Zivilschutz eine neue Schutzorganisation eingegliedert wird. Für Frauen soll nur der Orientierungstag obligatorisch werden. Die Armee und der Zivilschutz dürfen sich durch eine differenzierte Alimentierung nicht gegenseitig konkurrenzieren und weiter geschwächt werden.
Die Initiative «Service Citoyen» wurde Ende Oktober 23 eingereicht. Dieser Bürgerdienst beruht auf staatspolitischen Überlegungen und steht im Gegensatz zu den sicherheitspolitischen Anforderungen der Sicherheitsdienstpflicht. Äusserst irritierend ist die quasi Wahlfreiheit der Einsatzmöglichkeiten. Sie gefährdet eine ausreichende Alimentierung von Armee und Zivilschutz. Besonders stossend ist, dass für den Bürgerdienst quasi Personal gesucht wird, für das ein liberaler Staat Aufgaben definieren und Einsätze koordinieren muss. Unabhängig davon, ob sie gesellschaftspolitisch (Kohäsion) oder staatspolitisch (jeder leistet etwas) begründet wird, bleibt sie eine staatliche Belastung ohne klar definierten funktionalen Zweck. Hinzu kommen Ineffizienzen, Marktverzerrungen und ein enormer Verwaltungsaufwand.
Die SOG lehnt die Initiative «Service Citoyen» ab. Sie bringt sich aktiv ein, wenn diese für rechtsgültig erklärt wird.
Herzlichen Dank für Ihren persönlichen Beitrag für eine sichere Schweiz. Ich wünsche Ihnen und Ihren Nächsten frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr - in Frieden, Wohlstand und Gesundheit.
In eigener Sache
Der Vorstand der Schweizerischen Offiziersgesellschaft ist mit Ausnahme des Generalsekretariats und der Revisionsstelle dem Milizgedanken verpflichtet. Die ASMZ ist das Sprachrohr der SOG. Die zwölf Mitglieder des Vorstands werden an der Delegiertenversammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, ausgenommen der Präsident, für den fünf Jahre gelten. An der Delegiertenversammlung 2024 stehen drei Vorstandsmitglieder und der Finanzchef (FC) zur Neuwahl. Der Vorstand der SOG ersucht alle KOG und Fach OG, bis Ende 2023 Nachfolgerinnen oder Nachfolger an das Generalsekretariat zu melden.
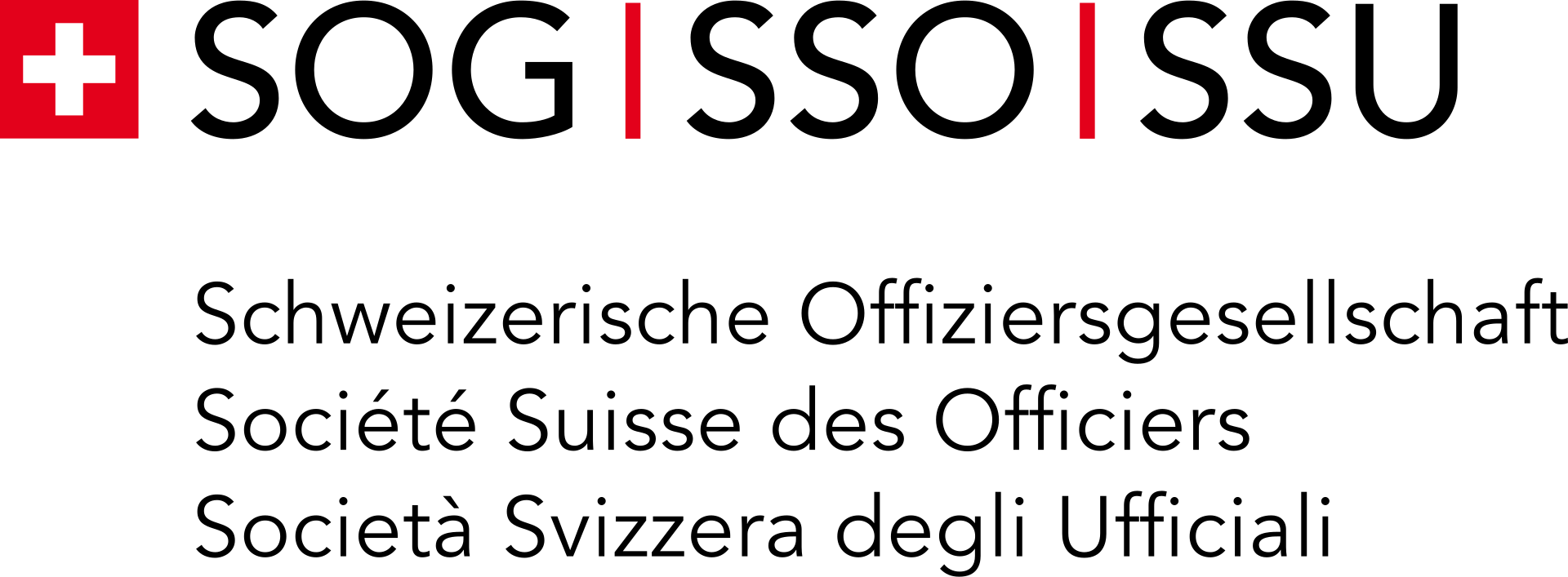
Kommentare und Antworten
Sei der Erste, der kommentiert